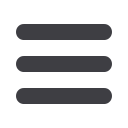

35
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
bereits in den 1980er Jahren wanderten viele als
„Reagan
Democrats“
zu den Republikanern ab – und jetzt sind sie
offensichtlich von denen enttäuscht genug, sich einem
Rechtspopulisten zuzuwenden.
Trumps Positionen sind genau auf diese Wähler zuge-
schnitten: Sie sehen sich als Opfer von Globalisierung und
Freihandel, sie empfinden Einwanderer als wirtschaftliche
Konkurrenz und kulturelle Bedrohung. Die Priorisierung
von Minderheiten- und Frauenrechten durch die Demo-
kratien nehmen sie als Verlust der eigenen gesellschaftli-
chen Bedeutung wahr,
„Political Correctness“
ist für sie
Zensur. Das außenpolitische und militärische Engagement
der USA interpretieren sie als Ressourcenverschwendung
auf ihre Kosten, gleichzeitig fürchten sie Terrorismus durch
Muslime im eigenen Land. Die Proteste von
„Black Lives
Matter“
begreifen sie als Bedrohung der öffentlichen Ord-
nung. Trumps Slogan
„Make America Great Again“
spricht
diese Wähler in besonderem Maße an und weckt nostal-
gische Erinnerungen an die USA der 1950er und1960er
Jahre als Amerikas Wirtschaftsmacht und die kulturelle
Dominanz weißer Männer noch ungebrochen schien.
Natürlich punktet Trump nicht nur bei „zornigen wei-
ßen Männern“ ohne höhere Bildung, aber diese Gruppe
bildet den harten Kern seiner Unterstützer. Bei anderen
normalerweise republikanischen Wählergruppen steht er
deutlich schlechter da. Trump setzt darauf, seine Unter-
stützer in einem derart ungeahnten Ausmaß an die Urnen
zu locken, dass sie seine Schwächen bei anderen Wählern
ausgleichen.
Die ewige Kandidatin: Hillary Rodham Clinton
Die republikanische Nominierung Trumps kam überra-
schend, nicht so die Kür Hillary Clintons (geb. 1947) bei
den Demokraten. Clinton hatte schon fast alle Ämter der
Bundespolitik inne: Von 2009 bis 2013 war sie Außen-
ministerin, von 2001 bis 2009 Senatorin aus New York.
2008 bemühte sie sich bereits einmal um die Präsident-
schaftsnominierung, wurde aber von Obama in den Vor-
wahlen geschlagen. Nicht zuletzt wohnte Clinton bereits
von 1993 bis 2001 im Weißen Haus und war eine poli-
tisch höchst aktive
„First Lady“,
die eher Gesetzesinitiati-
ven vorbereitete als sich um Blumenschmuck für Staats-
empfänge zu kümmern. Clinton ist die wohl erfahrenste
Politikerin der Demokraten und die Anführerin des
moderaten Flügels. Kein anderer Demokrat hat ein derart
gut ausgebautes Netzwerk an Unterstützern und Geldge-
bern. Als sie im April 2015 ihre Bewerbung um das Präsi-
dentschaftenamt bekannt gab, galt ihre Nominierung als
faktisch ausgemacht.
Feel the Bern: Clintons Kampf um die Nominierung
Doch es kam anders: Der demokratische Sozialist Bernie
Sanders, ein parteiloser, aber mit den Demokraten ver-
bündeter Senator aus Vermont entwickelte sich zu einem
ernstzunehmenden Konkurrenten für Clinton. Seine
Forderungen stammen aus den Parteiprogrammen lin-
ker europäischer Sozialdemokraten: höhere Steuern für
Reiche und Unternehmen, im Gegenzug Ausbau des
Sozialstaats auf skandinavisches Niveau, inklusive gebüh-
renfreiem Studium an staatlichen Hochschulen und staat-
licher Krankenversicherung für alle. Vor allem prangert
Sanders die extreme Konzentration von Einkommen und
Vermögen bei den reichsten Amerikanern an, während die
wirtschaftliche Lage der Mehrheit immer prekärer wird.
Er fordert daher eine konsequente Umverteilung von oben
nach unten durch den Bund. Für europäische Verhältnisse
sind das keine übermäßig radikalen Forderungen, für die
USA hingegen schon. Dennoch, oder gerade deswegen,
konnte Sanders eine enthusiastische Bewegung hinter sich
sammeln, vor allem junge Wähler und den linken Partei-
flügel der Demokraten. Sanders profitierte dabei vom sel-
ben Unmut über den Status Quo wie Trump, allerdings
mit linkspopulistischen Forderungen, nicht rechtspopulis-
tischer Fremdenfeindlichkeit.
Nun befürwortet auch Hillary Clinton höhere Steuern
für Reiche, höhere Mindestlöhne und bessere Sozialleistun-
gen, schließlich gehört der Ausbau des Sozialstaates neben
dem aktiven Schutz von Minderheiten- und Frauenrechten
zum Markenkern der demokratischen Partei. Allerdings
stammt Hillary Clinton genau wie ihr Mann Bill aus dem
moderaten Flügel der Demokraten, der eine sozialliberale,
aber zugleich wirtschaftsfreundliche Politik anstrebt. Das
bedeutet eine progressive Steuerpolitik bei gleichzeitiger
Rücksichtnahme auf Unternehmen, um Arbeitsplätze und
Wirtschaftswachstum nicht zu gefährden, sowie Sozial-
leistungen vor allem für Bedürftige und nicht so flächen
deckend und weitgehend, wie Sanders es fordert.
Es gibt also auch bei den Demokraten konkurrierende
Parteiflügel, allerdings ist die inhaltliche Schnittmenge
bei diesen größer und der Streit nicht so bitter. Insge-
samt sind die Demokraten in den letzten 20 Jahren weiter
nach links gerückt, auch Clintons Positionen heute sind
erheblich progressiver als in den 1990er Jahren oder sogar
2008. Der Vorwahlkampf der Demokraten war eine rela-
tiv normale Auseinandersetzung zwischen parteiinternen
Lagern, die Clinton mit klarer, aber nicht großer Mehr-
heit für sich entscheiden konnte. Sanders gelang es nicht,
Obamas Überraschungssieg gegen Clinton von 2008 zu
wiederholen, auch weil er bei allem Erfolg kein so inspi-


















