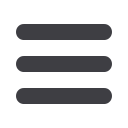

69
Dabei war das Mitverantworten des Schullebens zugleich Anspruch an sich selbst. Das Recht auf
Selbstbestimmung und der Anspruch sich selbst zu erziehen, um sich aus eigener Kraft zu entwickeln,
waren für die Schüler damals nicht Gegensätze, sondern zwei Ausprägungen der gleichen Haltung. Im
gemeinsamen Arbeiten lernten die Schüler Verantwortung zu übernehmen, sich gegenseitig zu unter-
stützen, zuverlässig zu sein und, nicht zuletzt, sich am gemeinsam Geleisteten zu freuen. Dies war der
neue Geist, der damals durch die Schullandschaft wehte.
Die radikalen Neuanfänge in Wickersdorf und anderenorts blieben nicht ohne Folgen für uns in Bayern:
Im Jahr 1918, nach dem Sturz der Monarchie, ergingen von den preußischen und bayerischen Kultus-
ministerien erste Bestimmungen mit dem Ziel, Schülervertretungen einzurichten. In einem Aufruf des
preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung von damals heißt es:
„An jeder höheren Schule […] findet alle zwei Wochen einmal zu einer zum lehrplanmäßigen Unter-
richt gehörenden Stunde eine ,Schulgemeinde‘ statt, d. h. eine völlig freie Aussprache von Lehrern
und Schülern über Angelegenheiten des Schullebens, der Disziplin, der Ordnung usw. Die Leitung
der Versammlung hat ein von der Schülerschaft in geheimer, gleicher Wahl ernannter Lehrer zu
übernehmen. An der Schulgemeinde hat der Leiter der Schule und das ganze Kollegium teilzuneh-
men sowie alle Schüler […]. Die Schulgemeinde kann ihre Wünsche und Meinungen […] zum Aus-
druck bringen […]. In der Schulgemeinde hat jeder Schüler und Lehrer eine Stimme; […].“
1
Diese Schulgemeinde durfte einen Schülerrat wählen, der die Interessen der Schülerschaft zu vertreten hatte.
Auch in Bayern sollten in ähnlicher Weise Schülerausschüsse als ständige Vertretung zusammentreten
und außerdem Schülerversammlungen gefördert werden, um freie Aussprachen zwischen Lehrern und
Schülern zu ermöglichen.
Im Nationalsozialismus wurde den Bemühungen um mehr Mitbestimmung in den Schulen ein radika-
les Ende bereitet. Schülervertretungen waren nun in die Organisationen des nationalsozialistischen
Systems zwangseingegliedert. So heißt es im Brockhaus aus dem Jahre 1938 unter „Schulgemeinde“
nur noch:
„Die Zusammenfassung von Eltern, Lehrern und Vertretern der HJ an einer Schule […]. Führer
der Schulgemeinde ist der Schulleiter, dem eine Anzahl von Jugendwaltern aus Lehrerschaft, Eltern-
schaft und HJ beratend beigegeben sind.“
2
3.3.3 SMV in der DDR
In der sowjetischen Besatzungszone wurden bis 1949 Richtlinien zu den Schülervertretungen erlassen,
die den Schülerselbstverwaltungskonzepten der Reformpädagogen noch weitgehend entsprachen.
Teilweise entwickelten sich weitreichende Ansätze für die Vertretung von Schülerinteressen.
Ab 1949, also mit der Gründung der DDR, gerieten die vorher gebildeten Schülerselbstverwaltungsaus-
schüsse jedoch immer stärker in Konflikt mit den sozialistischen Gruppen der so genannten „Pioniere“
(„Junge Pioniere“ und „Thälmann-Pioniere“) sowie der „Freien Deutschen Jugend“ (FDJ). So gab es ab
Anfang der 50er-Jahre keine organisierte Schülermitbestimmung mehr. Stattdessen wurden für Schüler
in den ersten Schuljahren die Pionier-Organisationen und für schon etwas ältere, jugendliche Schüler
die linientreue FDJ an den Schulen verankert. Die Beteiligung der Schüler erfolgte nunmehr mithilfe der
Leitung der FDJ. Ziel der Schule war es,
„dass die Kinder zu Menschen mit sozialistischem Bewusstsein
erzogen werden“
, um
„die Erziehung […] mit dem Kampf der Werktätigen für den Sieg des Sozialismus
zu verbinden
.
“
3
1 Zitiert nach: Scheibe: Schülermitverantwortung – Ihr pädagogischer Sinn und ihre Verwirklichung. Luchterhand, Berlin-Spandau. 1962
2 Der Neue Brockhaus. Allbuch in vier Bänden und einem Atlas. F. A. Brockhaus. Leipzig. 1938
3 Ulbricht: Der Kampf um den Frieden, für den Sieg des Sozialismus, für die nationale Wiedergeburt Deutschlands als friedliebender, demo-
kratischer Staat. Referat und Schlusswort auf dem V. Parteitag der SED. Dietz. Berlin. 1958



















