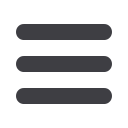

64
3.2.2 Pflichten
Die Schule könnte diese – durch die Bayerische Verfassung und das Bayerische Erziehungs- und
Unterrichtsgesetz gestellten – Aufgaben nicht erfüllen, wenn den Rechten des Schülers nicht auch
Pflichten entsprächen. Und ganz selbstverständlich sind die Rechte und Pflichten des Schülers immer
im Zusammenhang mit den Rechten und Pflichten der anderen Beteiligten – seien es Mitschüler, Eltern
oder Lehrer – zu sehen. Auf die oben beschriebenen Schülerrechte könnt ihr euch also nur so lange
berufen, wie ihr auch die damit einhergehenden Pflichten erfüllt (Art. 56 Abs. 4 BayEUG).
Dabei hat das Wort „Pflicht“ nichts mit Zwang zu tun. Es leitet sich von „pflegen“ ab, im Sinne des
Einstehens für etwas und des Sich-Kümmerns um eine anvertraute Sache. Es steht also für eine aus
Einsicht zu erfüllende Aufgabe für eine Gemeinschaft oder ein größeres Ganzes. Zwei Beispiele für
solche Pflichten wollen wir kurz erläutern:
1. Die Rechte von anderen, z. B. von anderen Mitgliedern der Schulgemeinschaft, sind zu wahren.
Die zugestandenen Rechte dürfen also nicht die Rechte anderer einschränken. Wenn Unterricht und
Erziehung in Frage gestellt würden, könntet ihr die oben genannten Rechte nicht mehr für euch bean-
spruchen.
2. Die Funktionsfähigkeit der Schule muss erhalten bleiben.
Schüler haben sich bei der Wahrnehmung ihrer Rechte so zu verhalten, dass die Aufgabe der Schule
erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Dazu gehört auch, alles zu unterlassen, was den
Schulbetrieb stören könnte, bspw. besagte Demonstration während der Mathe-Stunde.
Daneben ist es natürlich wichtig, dass ihr über das nötige Sachwissen verfügt, wie es in einigen der
Beteiligungsbereiche erforderlich ist. So könnt ihr in der Regel nicht für euch beanspruchen, über bau-
liche Maßnahmen zu bestimmen. Hier gibt es Grenzen der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in
der Schule, so wie das in allen anderen Lebensbereichen, z. B. beim Wahlrecht, auch der Fall ist.
Und ganz grundsätzlich muss die Verantwortungsfähigkeit gegeben sein. Übertrüge man Schülern
nämlich Aufgaben, für die sie noch zu jung sind, so würden sich möglicherweise Misserfolge einstellen
und die Freude an der SMV-Arbeit verginge diesen Schülern schon bald.
Andererseits benötigen Jugendliche Erprobungs- und Bewährungsräume, die mit zunehmender Reife
und Verantwortungsfähigkeit behutsam, aber bestimmt erweitert werden. Schülermitverantwortung
sollte also der Altersstufe gemäß langsam aufgebaut werden. Indem sich jeder einzelne von euch – zu-
nächst vielleicht im kleinen Rahmen – an der Gestaltung eurer Schule beteiligt, erwerbt ihr die not-
wendigen Fähigkeiten, um schließlich auch noch weiterreichende Rechte wahrzunehmen.
3.3 Wie entstand die heutige SMV?
Lernstoff, der euch in eurem Leben nicht weiterhilft und vielleicht nie wieder begegnet? Lehrer, die
Unterricht und Schulleben mit starren Vorgaben bestimmen, Entscheidungen willkürlich treffen und
scheinbar an kein Recht gebunden sind? Leere, dort wo es um die Entwicklung von Bezügen zur Natur
oder zum eigenen Körper, um die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit hätte gehen können?
Was in eurem Schulalltag so hoffentlich nicht mehr vorkommt, gehörte in der Kindheit und Jugend
eurer Großeltern wahrscheinlich noch häufig zum Schulalltag. Das ist lange her, aber warum ist es nicht
so geblieben?
Kompetenz für die Zukunft gibt es nicht ohne Wissen über die Herkunft. Wir laden euch daher ein, uns
auf einer kleinen Reise durch die Geschichte des Schülerdaseins zu begleiten. Dabei nehmen wir auch
die Beteiligung der Schüler am Schulleben unter die Lupe und fragen nach, was die Lehrer und Schul-
reformer damit bezweckten.



















