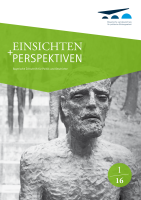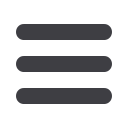

59
Der „Emigrantenstein“ von 1796: steinernes Zeugnis europäischer Geschichte
Einsichten und Perspektiven 1 | 16
Geprägt von der Aufklärung setzte Hardenberg moderne
staatliche Vorstellungen durch und führte 1796 u.a. das
Preußische Allgemeine Landrecht ein. Die Ära Preußens in
Bayreuth endet 1807. Es musste die Fürstentümer im Frie-
den von Tilsit an Kaiser Napoleon abtreten. Das „französi-
sche Intermezzo“ war nicht von langer Dauer. Camille de
Tournon (1778–1833), von Napoleon zum Gouverneur
der „Provinz Bayreuth“ bestimmt, wurde 1809 von den
in Bayreuth einmarschierenden Österreichern gefangen
genommen. Aufgrund des Pariser Vertrags von 1810 zwi-
schen Napoleon und König Max I. Joseph konnte Bayern
sein Territorium um das Fürstentum Bayreuth erweitern,
hatte jedoch hierfür aufgrund einer Geheimvereinbarung
die enorme Summe von fünfzehn Millionen Franken an
Kaiser Napoleon zu entrichten.
Ernst Moritz Arndt: Auf dem Weg von Bayreuth zum
Schloss Fantaisie am 19. Juni 1798:
„zog ein Stein zur linken Seite des Berges mein Herz an
sich, und meine Thränen aus den Augen. O ! auch ein
Emigré bleibt ein Mensch und menschlich sein gewalti-
ges Schicksal, welches ihm keine Stätte in der bewohn-
ten Welt zu lassen scheint. In diesen vorragenden grauen
Granitblock (!) waren … Worte gehauen, die freylich eher
bemoosen werden, als die denkwürdige Zeit woran sie
erinnern sollen: …“.
1
Die Markgrafschaft Bayreuth – Ansbach: Ende des
17. Jahrhunderts ein Ort früher „Willkommenskultur“
für Hugenotten
Um die Botschaft des „Emigrantensteins“ und seinen his-
torischen Hintergrund nach über zwei Jahrhunderten zu
verstehen, bietet sich ein Blick in das zweisprachige Stan-
dardwerk „Bayern und Frankreich. Wege und Begegnun-
gen. 1.000 Jahre bayerisch-französischer Beziehungen“ an.
In dem opulent ausgestattetenWerk werden die wechselvol-
len Beziehungen zwischen Bayern und Frankreich anhand
von Urkunden, Akten und Plänen aus den Archiven beider
Länder dokumentiert.
Bereits Ende des 17. Jahrhunderts wurden in den Mark-
grafschaften Ansbach-Bayreuth etwa 4.000 emigrierte
1 Ernst Moritz Arndt: Bruchstücke aus einer Reise von Baireuth bis Wien im
Sommer 1798, Bd. 2: Von Reisen durch einen Theil Deutschlands, Italiens
und Frankreichs in den Jahren 1798–1799, (1. Auflage) Leipzig 1801, S. 1f.
französische Protestanten – genannt Hugenotten – aufge-
nommen. 1685 widerruft der französische König Ludwig
XIV. das Toleranzedikt von Nantes. Als Vorkämpfer des
Katholizismus zwingt er die französischen Protestanten in
den Untergrund, ordnet den Abbruch ihrer Kirchen an
und sanktioniert das Verlassen Frankreichs mit Galeeren-
fron. Trotz des Verbots gelang fast 300.000 Protestanten
die Flucht aus ihrer französischen Heimat. Die überwie-
gend aus Handwerk und geschäftstüchtigem Bürgertum
stammenden Emigranten waren für ihre Aufnahmeländer
eine große Bereicherung. In den fränkischen Markgraf-
schaften wurde den hugenottischen Flüchtlingen großzü-
gig finanzielle Hilfe gewährt. Die bemerkenswerte Aufge-
schlossenheit des Markgrafen zeigte sich durch finanzielle
Hilfe bei der Gründung von Manufakturen sowie zeit-
lich befristeten Steuer- und Abgabebefreiungen. Bereits
wenige Wochen nach der Ankunft der ersten Hugenot-
ten im Jahr 1686 begann die Planung für eine neue Stadt
zur Ansiedlung von Gewerbe und Handel im Bereich des
heutigen Erlangen. 1687 erfolgte die Grundsteinlegung
für die Hugenottenkirche in der Neustadt Erlangens. Die
Integration der Hugenotten in Gesellschaft, Gewerbe und
Handel durch Manufakturen und Handelsunternehmen
führte zu einem enormen wirtschaftlichen Aufschwung in
Franken, der bis heute andauert.
Die Markgrafschaft Bayreuth – Ansbach als Zielort
französischer Emigranten während der Französischen
Revolution
Ein Jahrhundert später, Ende des 18. Jahrhunderts, kommt
es durch die Französische Revolution ab 1789 zu funda-
mentalen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Umwälzungen in Frankreich. In der Folge entsteht
eine innereuropäische Wanderungsbewegung, die vielfältige
Spannungen auslöste. Bedingt durch veränderte politische
Verhältnisse, aber auch aus Angst vor Verfolgung und der
damit verbundenen Gefahr für Leib und Leben emigrier-
ten zehntausende Menschen aller Stände aus Frankreich in
benachbarte Staaten. Bemerkenswert ist, dass selbst im Stan-
dardwerk „Bayern und Frankreich. Wege und Begegnungen.
1.000 Jahre bayerisch-französischer Beziehungen“ die Auf-
nahme mehrerer Tausend französischer Revolutions-Emig-
ranten im heutigen Bayern mit keinemWort erwähnt ist.
2
2 Vgl. Michelle Magdelaine: Le refuge huguenot en Bavière. Die Zufluchts-
stätte der Hugenotten in Bayern in: France-Bayern, Bayern und Frank-
reich. Wege und Begegnungen. 1.000 Jahre bayerische-französische
Beziehungen. France-Bavière allers et retours. 1.000 ans de relations
franco – bavaroises, hg. v. Staatl. Archiven Bayerns, Centre historique des
Archives nationales Paris, Montgelas-Gesellschaft, Paris 2006.