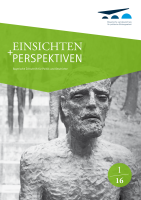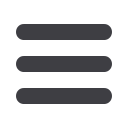

58
Der „Emigrantenstein“ von 1796: steinernes Zeugnis europäischer Geschichte
Einsichten und Perspektiven 1 | 16
Jahre stand dort der Hinweis „Gedenktafel für [!] einen
französischen Emigranten“. Erst im Januar 2016 erfolgte
nunmehr die Berichtigung mit dem zutreffenden Text
„Gedenkstein, Danksagung eines französischen Emigran-
ten für gewährtes Asyl, in den Sandsteinfelsen gehauene
Inschrifttafel, bez. 1796“. Die Inschrift selbst ist – bis-
lang – dem offiziellen Listeneintrag nicht beigefügt. Wer
sich also mit den Besonderheiten des Denkmals befassen
will, muss sich an Ort und Stelle begeben.
Die digitale Suche nach literarischen Hinweisen auf
den „Emigrantenstein“ erweist sich als wenig ergiebig. Der
Wortlaut der Inschrift findet sich nur in dem 1984 von Eli-
sabeth Roth herausgegebenen Werk „Oberfranken in der
Neuzeit bis zum Ende des Alten Reichs“, das bisher nicht
als Digitalisat zugänglich ist. Matthias Winkler bezieht
sich in seiner Arbeit „Die Emigranten der Französischen
Revolution in Hochstift und Diözese Bamberg“, seit 2010
abrufbar als Onlineversion im Hochschulschriftenserver
der Universität Bamberg, hierauf und druckt den Text
der Inschrift vollständig ab. Über eine lokalgeschichtliche
Veröffentlichung, den „Hummelgauer Heimatboten“, und
die darin dokumentierten Reisebeschreibungen aus den
Jahren 1692 bis 1966 erschließt sich eine authentische
historische Quelle: Im Sommer 1798 wanderte der junge
Schriftsteller Ernst Moritz Arndt (1769–1860) von Bay-
reuth nach Wien. Er setzt dem „Emigrantenstein“ ein frü-
hes literarisches Denkmal. In der ersten Auflage seiner Rei-
sebeschreibung „Bruchstücke einer Reise von Baireuth bis
Wien“, erschienen 1801 in Leipzig, gibt Arndt nicht nur
den Wortlaut der Inschrift wieder, sondern dokumentiert
auch seine Empathie für das Schicksal der französischen
Emigranten mit den Worten: „Auch ein Emigré bleibt ein
Mensch und menschlich sein gewaltiges Schicksal, welches
ihm keine Stätte in der bewohnten Welt zu lassen scheint.“
In der zweiten Auflage dieser Publikation im Jahr 1804 ist
der Hinweis auf den „Emigrantenstein“ entfallen.
Die Danksagung des „französischen Ausgewanderten“
auf dem „Emigrantenstein“ an König Friedrich Wilhelm
II. und dessen Minister Carl August von Hardenberg lenkt
den Blick auf die besondere geopolitische Situation des
Bayreuther Landes. Der starke Einfluss des Königreichs
Preußen auf die hohenzollern’schen Fürstentümer Bayreuth
und Ansbach geht auf das Jahr 1792 zurück. Hardenberg,
vom preußischen König Friedrich Wilhelm II. als Minis-
ter eingesetzt, regierte in den beiden Fürstentümern ab
1792 bis zu seiner Rückkehr nach Berlin „wie ein König“.
Ansicht Bayreuths um 1800
Abbildung: Historisches Museum Bayreuth