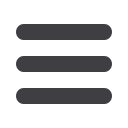

|27 |
aviso 1 | 2017
NISCHEN IM FOKUS
:
COLLOQUIUM
oben
Das Seminar als Ort der wissenschaftlichen
Diskussion – Vertiefungsseminar Griechisch an der LMU.
darunter
Archäologie als Mittlerin zwischen Geistes-
und Naturwissenschaften – Professor Dr. R. Gebhard
(Archäologische Staatssammlung München) mit
Doktoranden aus Basel, Berlin und München im Labor.
Professor Dr. Martin Hose
lehrt Griechische
Philologie an der Ludwig-Maximilians-Universität
München. Seit 2001 ist er Ordentliches Mitglied
der bayerischen Akademie der Wissenschaften, von
2007 bis 2015 war er Vorsitzender des Senats
der LMU und Stellvertretender Vorsitzender des
Hochschulrats. Seit 2012 ist er Sprecher der
Graduate School »Distant Worlds«.
Die Kleinen Fächer: Ein Überblick
Ein Verzeichnis der Kleinen Fächer und ihrer Universitätsstandorte in Deutschland bietet die
Arbeitsstelle Kleine Fächer auf der Website www.kleinefaecher.deetwa an Skandinavistik oder Baltistik – ist die Konstellation natürlich
anders), bricht dort die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses ein, Professuren durch internationale Bewerber leicht besetzen zu
können.
Neue Wege der Kooperation
In den altertumswissenschaftlichen Kleinen Fächern gibt es vielerorts
eine seit längerem praktizierte organisatorische und auch wissenschaft-
liche Kooperation. So ist etwa in den neuen Bundesländern bei der
Reorganisation vieler Universitäten darauf Wert gelegt worden, grö
ßere altertumswissenschaftliche Institute zu schaffen. So wurden etwa
in Halle, Jena, Rostock und Greifswald Alte Geschichte, Klassische
Archäologie, Latinistik und Gräzistik miteinander verbunden. Dies
hatte durchaus positive Folgen für die Konzeption von Studiengängen,
für die jeweils gemeinsame Fachbibliothek und auch gemeinsame For-
schungsvorhaben. Auf anderen Seite – dies ist am ›Schicksal‹ des In-
stituts für Altertumswissenschaften in Greifswald zu erkennen – kann
dann bereits die Streichung einer einzigen Professur (in der Greifswald
war es die Klassische Archäologie) den Anfang vom Ende des gesam-
ten Instituts bedeuten.
AN ANDEREN STANDORTEN
haben sich die Altertumswissenschaften
(wie übrigens auch andere Felder der Kleinen Fächer) zu fakultätsüber-
greifenden Zentren zusammengeschlossen, die als gemeinsame Platt-
formen einerseits der inneruniversitären Profilbildung, andererseits der
Förderung von gemeinsamen Forschungsprojekten dienen. Betrachtet
man als Gradmesser für die Wirksamkeit dieser Maßnahme die Exzel-
lenz-Initiative, so fällt auf, dass gerade die Kleinen Fächer hier durchaus
Erfolge verbuchen konnten: In der letzten Runde dieses Wettbewerbs
2012 konnten sich zwei maßgeblich von den Kleinen Fächern getrage-
ne geisteswissenschaftliche Cluster behaupten: ›Topoi – Die Formation
und Transformation von Raum und Wissen in den antiken Kulturen‹
(gemeinsam von FU und HU Berlin getragen) und ›Asien und Europa
im globalen Kontext: Die Dynamik der Transkulturalität‹ (Universität
Heidelberg). Noch deutlicher wird die Leistungsfähigkeit der Kleinen
Fächer in der sog. ›ersten Förderlinie‹, in der insgesamt 45 Graduier-
tenschulen bewilligt wurden. 11 dieser Schulen können dem Bereich
der Geisteswissenschaften zugerechnet werden. Von diesen werden
immerhin sechs Schulen von den Kleinen Fächern getragen. Oder mit
Blick auf Bayern: Von den hier insgesamt 9 erfolgreichen Anträgen die-
ser Förderlinie stammen fünf aus den Natur- und Lebenswissenschaf-
ten, einer aus demBereich der Sozialwissenschaften. Die verbleibenden
drei Anträge wurden von Vertretern der Kleinen Fächer vorgelegt: die
›Bayreuther Internationale Graduiertenschule für Afrikastudien‹, die
›Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien‹, die gemeinsam
von der LMU und der Universität Regensburg getragen werden, und
›Ferne Welten: Altertumswissenschaftliches Kolleg München‹, das an
der LMU angesiedelt ist.
Man kann diesen Erfolg der Kleinen Fächer als ein klares Argument
für ihre Bedeutung und ihr Potenzial, überzeugende interdisziplinäre
Forschungs- und Qualifikationsprogramme zu entwickeln, sehen. Dass
gerade besondere Chancen und Perspektiven zwischen den (vermeint-
lich) großen Disziplinen für neue Ideen – auch zu alten Kulturen und
Texten – verborgen sind, könnte ein wichtiges Argument für Er
haltund Pflege der Kleinen Fächer sein.


















