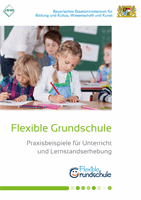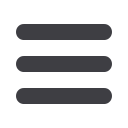

89
2 Lerndokumentation und Leistungserhebung in der Flexiblen Grundschule
2.3 Portfolio
Das Instrument des Portfolios wird als eine gute Möglichkeit bewertet, verschiedene Aufträge der Flexiblen
Grundschule zu vereinen: Die Schülerinnen und Schüler lernen individuell, aber im Rahmen eines gemeinsa-
men Themas und gemeinsamer Aufgabenstellungen. Die Heterogenität wird genutzt durch geplante Lernsi-
tuationen, in denen Teams gemeinsam eine Aufgabe und verschiedene Lösungsmöglichkeiten besprechen,
sich gegenseitig beraten und auch Rückmeldung zu den Entwürfen der Mitschülerinnen und Mitschüler
geben. Gleichzeitig entstehen innerhalb des gemeinsamen Rahmens individuelle und sehr aussagefähige
Schülerprodukte. Sie dienen der individuellen Rückmeldung an Kind und Eltern und ermöglichen sowohl
einen Vergleich mit den Kompetenzerwartungen des Lehrplans (als kriterialer Bezugsnorm) sowie einen Ver-
gleich mit den anderen Schülerinnen und Schülern der Lerngruppe (als sozialer Bezugsnorm).
Ein Portfolio bietet somit die Möglichkeit, den individuellen Lernprozess und -erfolg von Schülerinnen und
Schülern transparent und nachvollziehbar zu machen, auch indem hier persönliche Interessenschwerpunkte
deutlich gemacht und verfolgt werden können. Die Kinder sammeln eigenständig Lernergebnisse und Un-
terlagen, die sie zu einem Thema angefertigt haben. Ebenso reflektieren die Lernenden ihre Lernprozesse
und planen: Was habe ich Neues gelernt? Wie habe ich mit anderen zusammengearbeitet? Was möchte ich
jetzt noch zum Thema wissen?
Über das Portfolio und die Qualität der einzelnen Dokumente erhält das jeweilige Kind eine Rückmeldung
durch die Lehrkraft. Um die Kriterien transparent zu machen und auch für ein Elterngespräch nutzen zu
können, kommen auch Rückmeldebögen zum Einsatz. Werden Portfolios benotet, ist es unerlässlich, dies
im Vorfeld bekannt zu machen, die Bewertungskriterien offenzulegen und anschließend auf dieser Basis die
Note zu begründen. Die Bewertungskriterien können sich dabei sowohl auf den Prozess der Erstellung des
Portfolios als auch auf das Produkt selbst beziehen.
Täglich ist Lernzeit in der Schule für die Arbeit am Portfolio reserviert, in der die Schülerinnen und Schüler le-
sen, diskutieren, ihre Arbeitsschritte aufteilen, zeichnen und schreiben sowie die Anordnung der Information
auf ihren Dokumenten besprechen. Die Lehrkraft gibt selbst Hilfestellung, stellt Unterlagen zur Verfügung
und berät oder wählt Schülerinnen und Schüler aus, die anderen auf Nachfrage Unterstützung und Hinweise
geben. Ggf. stellt auch die Lehrkraft gezielt Tandems oder Teams zusammen, um die Heterogenität zu nut-
zen und dadurch das Lernen voneinander zu unterstützen.
Im Laufe der gesamten Lernzeit finden regelmäßig Plenumsrunden statt, in denen die Schülerinnen und
Schüler über ihren Arbeitsstand und ihre Lernergebnisse berichten. So ist sichergestellt, dass die Schülerin-
nen und Schüler genügend Unterstützung und Anregung erhalten, um Erfolge und präsentable Ergebnisse
zu erzielen. Zusätzlich dazu gibt es gezielte Hilfen während der täglichen Lernzeit.
Am Ende der Portfoliophase präsentieren die Schülerinnen und Schüler ihre Forschungsergebnisse und stel-
len ihre Dokumente im Klassenzimmer aus. Jedes Kind erhält einen Termin, um die eigenen Lernergebnis-
se der Klasse vorzustellen. Dabei begründen die Schülerinnen und Schüler auch ihre Entscheidung für die
Auswahl des jeweiligen Forscherauftrags, schildern ihre Vorgehensweise und beantworten Fragen zu ihren
ausgestellten Lernergebnissen.
Die Erstellung eines Portfolios, so die Erfahrung der Lehrkräfte, lässt besonders die individuellen Unterschiede
zwischen den Schülerinnen und Schülern sehr deutlich zutage treten, sowohl in fachlicher Hinsicht als auch,
was das Lern- und Arbeitsverhalten betrifft. Die Kinder setzen unterschiedliche Schwerpunkte, sie verwenden
unterschiedlich viel Sorgfalt für die Ausführung und benötigen unterschiedlich viel Hilfe dabei, das Thema und
bestimmte Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Benötigen die Schülerinnen und Schüler beim ersten Portfo-
lio noch viel Unterstützung, gehen sie bereits bei einem zweiten schon viel selbständiger und zielstrebiger vor.
Portfolios haben einen fachlichen Schwerpunkt, sind aber in der Regel immer fächerverbindend, wie die
folgenden Beispiele zeigen. Wenn im HSU-Unterricht Skizzen beschriftet, Sachtexte verfasst und Lernergeb-
nisse vorgestellt und reflektiert werden, erweitert dies immer auch die Sprech-, Lese- und Schreibkompetenz
der Schülerinnen und Schüler. Aus diesem Grund sind zentrale Kompetenzerwartungen des Fachlehrplans
Deutsch mit aufgelistet.