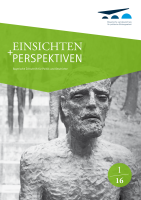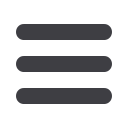

35
Władysław Bartoszewski, der Brückenbauer
Einsichten und Perspektiven 1 | 16
In seinen autobiografischen Betrachtungen gab Władysław Bartoszewski dem
Kapitel, in dem er seine Inhaftierung nach Ausrufung des Kriegsrechts am
13. Dezember 1981 und die Festsetzung zusammen mit zahlreichen anderen
Oppositionellen im Internierungslager Jaworze bei Drawsko beschreibt, den Titel
„Es lohnt sich anständig zu sein“.
1
Mit einem spitzbübischen Lächeln fügte er
dem häufig noch hinzu: „Es lohnt sich, ehrlich zu sein, obwohl es sich nicht
immer auszahlt. Es zahlt sich aus unehrlich zu sein, aber es lohnt sich nicht.“
Dies ist gewissermaßen die Quintessenz eines langen, erfahrungsreichen Lebens.
Jugendzeit
Władysław Bartoszewski wurde am 19. Februar 1922
in Warschau geboren. Er wuchs in einer recht typischen
Warschauer Mittelschichtsfamilie auf – sein
Vater war
Bankangestellter, seine Mutter besuchte nach dem Abitur
die Handelsschule und arbeitete später als Buchhalterin.
Bartoszewski legte seine Abiturprüfung im Mai 1939
an einer katholischen Privatschule ab. Die ihn damals
prägenden Erfahrungen und seine Zukunftsvorstel-
lungen fasste er 1987 in seiner Vorlesung anlässlich des
Geschwister-Scholl-Gedenktages an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München in folgende Worte: „Ich gehöre
der Generation an, deren Jugend in die Zeit des
Zwei-
ten Weltkrieges fiel, also derselben Generation, der auch
Hans und Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Christoph
Probst, Willi Graf und die meisten anderen jungen Leute
angehörten, die mit der Studentengruppe der „Weißen
Rose“ verbunden waren. Meine Lehrer aber, die damals
mein Denken und meine Weltsicht mitzugestalten ver-
suchten und die sicherlich meine spätere Handlungsweise
beeinflussten, gehörten zu der Generation von Profes-
sor Kurt Huber. Ich interessierte mich für Literatur und
Geschichte. Meine Kollegen und ich lasen wahrscheinlich
die gleichen Standardwerke der europäischen Literatur, die
die Geschwister Scholl, Alexander Schmorell, Christoph
Probst und Willi Graf tief beeindruckt studierten. Wir
glaubten an die Zukunft Europas und zweifelten nicht
an der Richtigkeit christlicher Ideale. Wir lebten in der
schlichten Überzeugung, dass wir durch unser Studium,
durch Selbstbildung, Fleiß und Ehrgeiz bei der Gestaltung
einer besseren Zukunft für unser Volk und unseren Staat
1 Władysław Bartoszewski: Herbst der Hoffnungen. Es lohnt sich anständig
zu sein, hg. v. Reinhold Lehmann, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 1983,
S. 9–17.
Polen würden mitwirken können, wobei wir aber Europa
nicht aus dem Blick verlieren wollten. Wir sahen darin
nämlich keinen Widerspruch.“
2
Der 1. September 1939 veränderte alles. Es herrschte
Krieg. Alle Zukunftspläne waren hinfällig. Für den mili-
tärischen Dienst war Bartoszewski noch zu jung und auf-
grund seiner starken Kurzsichtigkeit auch nicht wirklich
geeignet. Er wollte sich jedoch nützlich machen und betä-
tigte sich als Sanitätshelfer bei der zivilen Verteidigung
Warschaus. Später fand er eine Anstellung beim Roten
Kreuz. Bei einer SS-Razzia, die sich gegen polnische Intel-
lektuelle in Warschau richtete, wurde Bartoszewski am
19. September 1940 verhaftet und am 22. September in
einer Gruppe von 1705 Gefangenen in das Konzentrati-
onslager Auschwitz verbracht. Es handelte sich um den
sogenannten „Zweiten Warschauer Transport“. Die Häft-
linge erhielten die Nummern 3.821 bis 4.959 und 4.961
bis 5.526. Auf Bartoszewski fiel die Nummer 4.427.
3
Beim Morgenappell wandte sich Lagerführer Karl Fritzsch
an „den Zugang“, wie die neu eingelieferten Häftlinge im
Lagerjargon hießen. Er sagte: „Schaut dort, der Kamin.
Schaut, das ist das Krematorium. Ihr geht alle ins Krema-
torium. 3.000 Grad heiß. Der Kamin ist der einzige Weg
ins Freie.“
4
Diese Szene verfolgte Bartoszewski jahrelang
und erschreckte ihn so, dass er – nach eigener Aussage –
selbst im Traum noch bleich geworden sei.
2 Władysław Bartoszewski: Kein Frieden ohne Freiheit. Betrachtungen ei-
nes Zeitzeugen am Ende des Jahrhunderts, hg. v. Nina Kozlowski, Baden-
Baden 2000, S. 137.
3 Władysław Bartoszewski: Mein Auschwitz, übers. v. Sandra Ewers u. Ag-
nieszka Grzybkowska, Paderborn 2015, S. 11–27.
4 Ebd., S. 28.