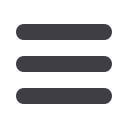
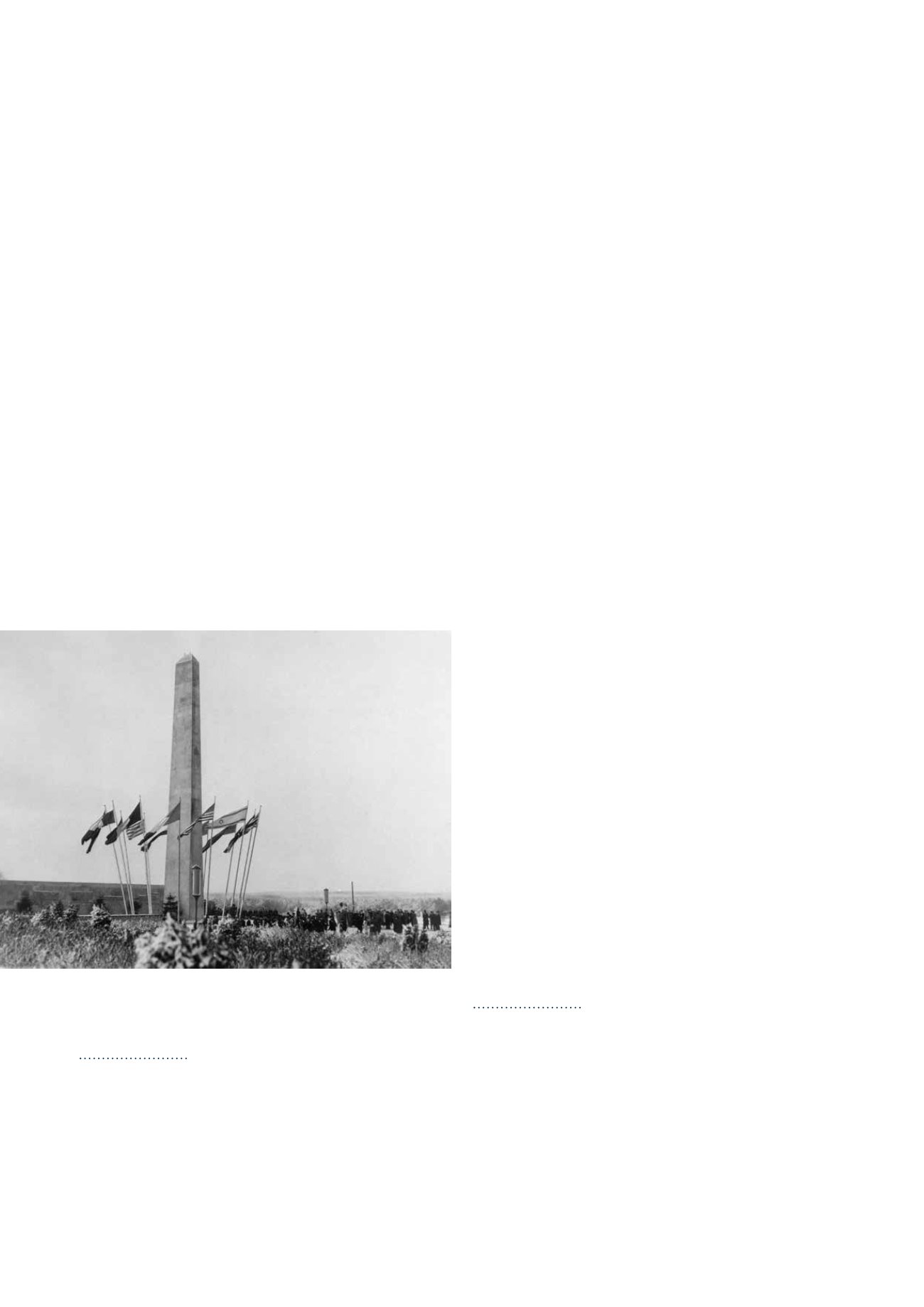
52
Die Entstehung von Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus
Einsichten und Perspektiven 2 | 17
die sich für ein würdiges Gedenken an die umgekommenen
Opfer einsetzen, während in der Mehrheit der Bevölkerung
ein Prozess des „kommunikativen Beschweigens“
7
einsetzt.
Man reklamierte für sich, dass man von den Verbrechen in
den Konzentrationslagern nichts gewusst habe und sah sich
zudem auch selbst als Opfer des Krieges.
Erste Gedenkstätten
Zu den ersten Gedenkstätten gehören Bergen-Belsen,
Flossenbürg und Langenstein-Zwieberge. Kurz nach der
Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen
8
durch
britische Truppen wurden die meisten Holzbaracken nie-
dergebrannt, um die Ausbreitung von Seuchen zu verhin-
dern. Zwischen 1946 und 1952 wurde auf Veranlassung
der britischen Militärregierung ein Teil des Geländes zu
einer Gedenkstätte umgestaltet, die als Heidelandschaft mit
Massengräbern jedoch keinerlei Bezug mehr zu der histo-
rischen Lagertopographie aufwies. Bei der Einweihung des
Internationalen Mahnmales am 30. November 1952 hielt
der damalige Bundespräsident Theodor Heuss eine vielbe-
achtete Gedenkrede, in der er sich zur Verantwortung der
Deutschen am Holocaust und an den Massenverbrechen
7 Vgl. Hermann Lübbe: Es ist nichts vergessen, aber einiges ausgeheilt. Der
Nationalsozialismus im Bewußtsein der deutschen Gegenwart, in: Frank-
furter Allgemeine Zeitung vom 24.01.1983, S. 9. – Kritisch dazu: Axel
Schildt: Zur Durchsetzung einer Apologie. Hermann Lübbes Vortrag zum
50. Jahrestag des 30. Januar 1933, http://www.zeithistorische-forschun- gen.de/1-2013/id%3D4679 [Stand: 05.04.2017].8 Vgl. Ulrike Puvogel/Martin Stankowski: Gedenkstätten für die Opfer des
Nationalsozialismus – Eine Dokumentation, Bd. I, Bonn 1995, S. 385 f.
des Nationalsozialismus bekannte und sich damit gegen
die in Politik und Gesellschaft weitverbreitete Tendenz des
Beschweigens und Verdrängens stellte: „Wer hier als Deut-
scher spricht, muß sich die innere Freiheit zutrauen, die
volle Grausamkeit der Verbrechen, die hier von Deutschen
begangen wurden, zu erkennen. Wer sie beschönigen oder
bagatellisieren wollte oder gar mit der Berufung auf den
irregegangenen Gebrauch der sogenannten ‚Staatsraison‘
begründen wollte, der würde nur frech sein.“
9
In Flossenbürg
10
befindet sich seit 1946 eine der ältes-
ten KZ-Gedenkstätten Europas. Sie geht nicht auf die
Initiative überlebender KZ-Häftlinge zurück, sondern
wurde von polnischen, nichtjüdischen Displaced Persons
(DPs), die 1946 in den Lagerkomplex eingewiesen wor-
den waren, in dem Bereich um das Krematorium und
den Schießplatz der SS errichtet – abseits des früheren
Konzentrationslagers. Das Konzept dieser Gedenkanlage
war durch „christliche Sakralisierung und historische De-
Kontextualisierung“
11
gekennzeichnet. Ende der fünfziger
Jahre wurde die Gedenkstätte durch eine Friedhofsanlage
ergänzt und ab Anfang der sechziger Jahre als „KZ-Grab-
und Gedenkstätte“ bezeichnet, in der lediglich das Toten-
gedenken gepflegt wurde, aber keine Aktivitäten im Sinne
einer „arbeitenden“ Gedenkstätte stattfanden. Zudem wur-
den weite Teile des ehemaligen KZ-Geländes gezielt nach-
genutzt, zerstört und bebaut.
In der sowjetischen Besatzungszone wurde im Septem-
ber 1949 am Ort eines ehemaligen Außenlagers des KZ
Buchenwald die Mahn- und Gedenkstätte Langenstein-
Zwieberge
12
eingeweiht, für die sich die überlebenden
Opfer dieses Lagers und die Vereinigung der Verfolgten
des Naziregimes eingesetzt hatten. Die Mahnmalanlage
umfasst mehrere Massengräber, einen Ehrenhain und ein
großes Denkmalsensemble.
In den ersten Jahren nach der Befreiung wurden aber
auch viele Orte von Verfolgung und Terror verändert,
umgenutzt und abgerissen. So wurde das ehemalige KZ
Neuengamme
13
in Hamburg nach einer Zwischennutzung
als britisches Internierungslager 1948 der Hamburger Jus-
9 Vgl
.http://www.theodor-heuss-haus.de/theodor-heuss/bundesrepublik/ [Stand: 25.03.2017]; Wortlaut der Rede unter: http://www.zeit.de/reden/ die_historische_rede/heuss_holocaust_200201 [Stand: 25.03.2017].10 Vgl. Jörg Skriebeleit: Flossenbürg – älteste Gedenkstätte Bayerns, in: Bayeri-
sche Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Hg.): Spuren des National-
sozialismus – Gedenkstättenarbeit in Bayern, München 2000, S. 130–149.
11 Ebd., S. 147.
12 Vgl. Stefanie Endlich u.a.: Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozia-
lismus – Eine Dokumentation, Bd. II, Bonn 1999, S. 557ff.
13 Vgl. Puvogel/Stankowski (wie Anm. 8), S. 234–240.
Staatsakt zur Einweihung der Gedenkstätte Bergen-Belsen auf dem Gelände
des ehemaligen Konzentrationslagers, 30. November 1952
Foto: ullstein bild


















