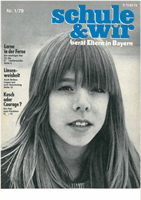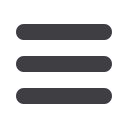

Fortsetzung von Seite 12
Wer dank Brille gut sieht, blickt im Unterricht besser durch.
Darum fördern bei sehschwachen Kindern auch Augenarzt
und Optiker oft den Schulerfolg.
Prozent! Ab dem 6. Lebens–
jahr führt eine Schielbehand–
lung kaum mehr zum vollen
Seh-Erfolg und nach dem
9. Lebensjahr ist fast nichts
mehr zu retten.. Bei Martin
mit seinen 5 Jahren handelt
der Arzt unverzüglich: Martin
erhält eine Brille. Er muß sie
ohne Unterbrechung den
ganzen Tag tragen, denn sie
dient dazu, das schwache
Auge zu ertüchtigen. Damit
aber das normale Auge nicht,
wie bisher, die ganze "Ar–
beit" übernimmt, wird es
künstlich ausgeschaltet, das
heißt zeitweise mit einem
Pflaster zugeklebt.
Regelmäßig muß Martin
·außerdem in die "Sehschule",
so heißt volkstümlich die
orthaptische Abteilung einer
Augenklinik oder Augen–
praxis. Dort stehen jene tech–
nischen Wunderapparate, mit
deren Hilfe es gelingt, die
Sehkraft schwacher Kinder–
augen zu steigern. Die Be–
handlung tut überhaupt nicht
weh; was ein bißchen schwer
fällt, ist nur das konzentrierte
Stillhalten vor den Geräten.
Martin ist kein Einzelfall.
ln der Bundesrepublik wer–
den jährlich Zehntausende
von Schielkindern geboren.
Allein an der Münchner Uni-
14
versitätsklinik sind pro Jahr
8000 bis 9000 in Behandlung.
Der größte Teil der Schielbe–
handlung sollte bis zur Ein–
schulung beendet sein. Ganz
abgeschlossen aber ist sie
erst nach der Pubertät.
Erst im zweiten Abschnitt
der Behandlung wird das
schielende Auge durch einen
operativen Eingriff in die
richtige Stellung gebracht. Da–
zu Dr. Manfred Freigang, Lei–
ter des Arbeitskreises "Schiel–
behandlung" im Berufsver–
band deutscher Augenärzte:
"Die Operation des schielen–
den Auges ist der sichtbare
Teil der Behandlung, durch
den die Augenstellung korri–
giert wird. Dieser Eingriff er–
setzt allerdings auf keinen
Fall die anderen Maßnahmen.
Welcher Zeitpunkt für die
Operation der günstigste ist,
kann allein der Arzt entschei–
den. ln der Regel zwischen
dem 4. und dem 6. Lebens–
jahr."
Martin sieht heute nie–
mand mehr an, daß e r früher
geschielt hat. Denn der Arzt
hat das Auge durch Opera–
tion richtig gestellt. Seine
Senleistung beträgt aber nur
60 Prozent. Wäre es früher
behandelt worden, meint der
Arzt, hätte man die Sehkraft
womöglich bis auf 100 Pro–
zent normalisieren können.
Aber auch mit dem jetzigen
Stand kann Martin zufrieden
sein. Eine ganze Reihe von
technischen Berufen, d ie ihm
sonst verschlossen gewesen
wären, stehen ihm offen.
Was können Eltern tun, um
bei ihren Kindern möglichst
frühzeitig Sehstörungen zu
erkennen? Dazu Frau Dr.
Sanden vom Bayerischen
Staatsministerium für Arbeit
und Sozialwesen: "Eltern
sollten ihre Kinder sorgfältig
beobachten. Bei Verdacht
sind der Hausarzt, Kinderarzt
oder Augenarzt Anlaufstel–
len. Daneben sollten Eltern
von den Vorsorgeuntersu–
chungen Gebrauch machen."
Die bayerischen Gesund–
heitsämter führen Reihenun–
tersuchungen schon in den
Kindergärten durch . Im Rah–
men der schulärztlichen Un–
tersuchungen mustern sie
auch alle Schulanfänger. Ein
modernes Testgerät ermittelt
rasch und problemlos, ob der
Verdacht auf eine Sehstörung
begründet ist. Die Eltern wer–
den dann in einem Schreiben
aufgefordert, ihr Kind dem
Augenarzt vorzustellen.
Weil Sehstörungen erfah–
rungsgemäß jederzeit, also
auch zwischen den schulärzt–
lichen Untersuchungen auf–
treten können, empfiehlt
Prof. Lund von der Augenkli–
nik der Un iversität München:
"Schon beim geringsten Ver–
dacht auf eine Sehschwäche
sollten Eltern ihre Kinder
fachärztlich untersuchen las–
sen. Besonders wenn es in
der Familie Brillenträger gibt,
oder Fälle von Schielen."
Manche Eltern reagieren
entsetzt, wenn es heißt: Das
Kind braucht eine Brille. Sie
halten das für einen Makel
und schämen sich. Tatsächlich
gibt es eine üppige Palette
von Vorurteilen über Brillen–
träger, die längst in die Mot–
tenkiste gehören. Grundsätz–
lich gilt: Die--negative Einstel–
lung zur Brille geht immer
von den Erwachsenen aus.
Kinder haben von sich aus
nichts gegen Brillen. Im Ge–
genteil: Manche empfinden
sie wert- und persönlichkeits–
steigernd, und werden des–
halbvon Kameraden beneidet.
Erst die ablehnende Hal–
tung der Erwachsenen, der
Schreckensruf
der
Oma
"Mein Gott, wie siehst denn
du aus!" macht Kinder un–
sicher. Umfragen haben je–
doch ergeben, daß seit eini-
ger Zeit ein Sinneswandel zu–
gunsten der Brille stattfindet.
Nicht zuletzt ein Verdienst
der Hersteller, die immer
schickere Brillen auf den
Markt bringen - neuerdings
auch für Kinder. Das eigens
für sie entworfene Brillenge–
stell trägt der kindl ichen Ge–
sichts- und Nasenform Rech–
nung. Es besteht aus robu–
stem Material, ist bruch- und
biegefest ·
Wenn Eltern ein solches
Modell und.dazu noch Kunst–
stoffgläser wählen, haben sie
gleichzeitig ein anderes Pro–
blem gelöst: Sie brauchen
dann keine Angst zu haben,
daß sich ihr Kind bei Spiel
und Sport an den Augen ver–
letzt. Im Gegenteil : Es gab
schon Fälle, in denen di
Brille als Augenschutz wirkte.
~
Kontaktlinsen, die moder–
nen unsichtbaren Sehhilfen,
werden aus hartem oder wei–
chem Kunststoff hergestellt
und direkt im Auge, auf der
Hornhaut getragen. Sie sind,
wie gut sie auch sitzen mö–
gen, Fremdkörper in den Au–
gen und darum manchmal
problematisch. Auch für klei–
ne Kinder kommen Kontakt–
linsen in Frage, aber sie sind
beim Einsetzen und Heraus–
nehmen der Linsen, beim Pfle–
gen und Aufbewahren auf die
Hilfe der Mutter angewiesen.
Wenn Kontaktlinsen nicht
peinlich sauber und steril ge–
halten oder wenn sie zu lan–
ge getragen werden, kommt
es zu schmerzhaften Augen–
entzündungen.
Die Brille ist zwar die wei
J
aus unkompliziertere Seh–
hilfe, dennoch schwärmen
die weiblichen Teenager für
Kontaktschalen. Eine S
&
W–
Biitzumfrage an 2 Münchner
Gymnasien, eines für Mäd–
chen, eines für Buben, ergab:
Mit.15 Jahren setzt der "Bril–
lenknick" ein. Dann greifen
nämlich die Mädchen lieber
zu Kontaktlinsen. Die jungen
Herren hingegen bleiben der
Brille treu.
ln unserer Zeit gehört gu–
tes Sehen ·zur Voraussetzung
für die meisten Berufe. Be–
sonders für die technischen,
aber auch für die Arbeit,
die am Schreibtisch stattfin–
det. Darum sind die Anfor–
derungen an die Senleistung
der Jugend heute höher. Es
ist also keine übertriebene
Vorsorge, wenn Eltern den
Augen ihrer Kinder beson–
dere Aufmerksamkeit schen–
ken, sondern eine dringend
gebotene Lebenshilfe.
e