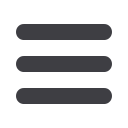

20
Historische Darstellungen in Computerspielen
Einsichten und Perspektiven 4 | 15
bis zur Reaktion auf die Herausforderungen der Spielwelt
reichen, ist ganz wesentlich für den Spielverlauf, die darin
entstehenden Bilder und die Ausgestaltung des Regelsys-
tems. Mit Blick auf den nächsten Abschnitt ist in diesem
Zusammenhang die Frage wichtig, ob diese Spielerhand-
lungen sich auf die zu erzeugenden Bildwelten oder auf
die Spielregeln hin orientieren, ob der Spieler sich mehr
als Hervorbringer einer Geschichte oder als Handelnder
in einem Regelsystem versteht. Die Antwort ist freilich
kein reines Entweder/Oder, sie ist sowohl vom Werk als
auch vom Spieler abhängig, der Aspekt des Ludischen darf
aber bei einer Analyse nicht außer acht gelassen werden.
Computerspiele und Gewalt
Eine der Fragen, die von außen regelmäßig an das Medium
herangetragen werden, ist die nach der Gewaltdarstellung.
Warum sind so viele Computerspiele so gewalthaltig? Die
Beantwortung dieser Frage fällt in den verschiedenen Berei-
chen des im ersten Abschnitts vorgestellten Analyseschemas
ganz unterschiedlich aus.
Historisch gesehen sind viele Spiele simulierte Konflikte,
von den Sportwettbewerben seit der Antike, über Brett- und
Kartenspiele, in denen der Sieg einer Partei mit der Nieder-
lage der übrigen Spieler verbunden ist, bis zu Geländespielen
wie Cowboy und Indianer, Räuber und Gendarm, Verste-
cken oder Fangen. Als Regelsystem haben alle diese Spiele
eine gewalthaltige Komponente, die allerdings abstrakt
oder symbolisiert ist. Bei Schach, Dame oder Mühle gehört
das Schlagen gegnerischer Figuren zu den Kernregeln, das
Opfern der eigenen Spielsteine gilt als Ausdruck gehobener
Strategie. Bei Skat, Doppelkopf oder Bridge werden die geg-
nerischen Karten „gestochen“, ein Wort, das seine Herkunft
im Lanzenstechen der Ritterturniere hat. Der Kulturhisto-
riker Johan Huizinga basiert in seinem Buch „
homo ludens
“
seine Kulturgeschichte auf der prägenden Kraft konkur-
renzbehafteter Spiele – Krieg, Rechtssystem, Wissenschaft,
Philosophie und Kunst sind demnach aus Wettbewerben
hervorgegangen und tragen dessen Wurzeln noch heute in
ihren kulturellen und sozialen Praktiken.
4
Computerspiele stehen in der Traditionslinie der analo-
gen Spiele, viele frühe Titel sind ausdrücklich Adaptionen
von Sport-, Schieß- und Wettkampfspielen. Dabei visua-
lisieren sie die Handlungsoptionen dieser Spiele in immer
detaillierteren Bildern, ohne deren ludischen Zweck zu
verändern: das Entfernen einer gegnerischen Spielfigur
aus der Spielwelt. Die zunehmende Drastik der audiovisu-
ellen Präsentation folgt dabei der medialen Überbietungs-
logik der Populärkultur, wonach jedes Werk seinen Vor-
gänger in zentralen Merkmalen zu übertreffen hat. Dazu
zählen Tabubrüche im Reality-TV, die Anzahl der visuel-
len Effekte in Blockbustern, die Produktions- und Mar-
ketingbudgets sowie die Darstellung von Gewalt in Kri-
mis, Psychothrillern, Actionfilmen oder Historiendramas.
Jeder Blockbuster erhöht die Schwelle dessen, was dem
Zuschauer als gerade noch zumutbar gilt. Computerspiele
sind hier keine Ausnahme, weil sie als Wirtschaftspro-
dukte den gleichen Marktmechanismen von Angebot und
Nachfrage gehorchen wie die gesamte Medienindustrie:
Das Publikum will explizitere Gewalt als im vergangenen
Jahr, also wird mehr Gewalt geboten, in Nahaufnahme,
Zeitlupe und stereoskopischem 3D.
Dieser menschliche Wunsch nach Gewalt, die aus
sicherer Entfernung und zur eigenen Unterhaltung rezi-
piert wird, ist ebenfalls tief in der Kulturgeschichte ver-
ankert. Homers Ilias, Shakespeares Dramen oder Grimms
Märchen sind voller impliziter, aber vor allem auch expli-
ziter Gewalt und dennoch oder vielleicht sogar gerade
deswegen unsterbliche Klassiker, weil sie die Themen des
Lebens zeitlos aufgreifen und publikumsnah darstellen.
„Unterhaltung formuliert – so läßt sich vielleicht pointiert
sagen – Sinn, dessen Bedeutung fraglich bleibt, während
im Kunsterlebnis etwas fraglos Bedeutendes rezipiert wird,
dessen Sinn fragwürdig bleibt.“
5
Wie so viele Unterhal-
4 Johan Huizinga: Homo Ludens: Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Reinbek
bei Hamburg (1939) 2004.
5 Hans-Otto Hügel: Ästhetische Zweideutigkeit der Unterhaltung. Eine Skizze
ihrer Theorie, vgl.
http://www.montage-av.de/pdf/02_01_1993/02_01_1993_Hans_Otto_Huegel_Aesthetische_Zweideutigkeit_der_Unterhaltung.pdf
[Stand: 27.11.2015].
Screenshot aus dem Spiel „Lord of the Rings: Campaign”
Bild: Electronic Arts GmbH


















